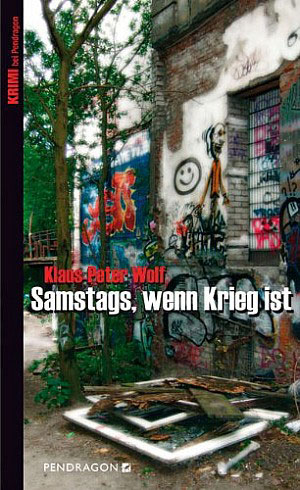Vom Autor zur Rampensau
Vom Autor zur Rampensau
Ein Erlebnisbericht nach 4000 Lesungen
Der geheimnisvolle Herr Bödecker
Ich war ein junger Autor, hatte ein paar Bücher veröffentlicht, die mehr schlecht als recht liefen. Um die ganze Wahrheit zu sagen: sie lagen wie Steine in den Regalen. Ich war gerade Vater geworden und die Menschen meiner Umwelt drängelten mich, den Traum vom freien Autorenleben aufzugeben und endlich vernünftig zu werden.
Ich war zwei Monatsmieten im Rückstand, der Hausherr drohte mit Kündigung. Schon zweimal hatte man mir Strom und Heizung abgedreht. Die Bank forderte meine Kreditkarte zurück. Ein Freund machte mir das Angebot, ich könne in seiner Versicherungsagentur arbeiten, bei meinem Talent, Lügengeschichten zu erfinden, sei ich geeignet für diesen Job.
Die einzige Einnahmequelle, die ich in diesem Monat hatte, kam von einer Lesung. In einer Buchhandlung konnte ich für einen berühmten Kollegen einspringen, der krank geworden war. 250 Mark.
Ich war so pleite, dass ich kein Geld zum Tanken hatte und ich kannte auch niemanden mehr, der mir noch etwas geliehen hätte.
Ich tankte trotzdem, ging zur Toilette der Tankstelle, knackte dort den Präserautomaten und zahlte mit Zweimarkstücken.
Die Lesung entschädigte mich für einiges. 25 Zuhörer, damals ein Riesenpublikum für mich. Ich sah, dass meine Bücher auf Interesse stießen. 9 Exemplare wurden verkauft, und, was meinem Autorenstolz sehr gut tat, man bat mich sogar um Autogramme.
Als ich zurückfuhr, wusste ich, so könnte ein Autorenleben aussehen. So könnte ich unabhängiger von der veröffentlichten Literaturkritik werden. Meine Zuhörer könnten sich selbst ein Bild von mir machen und sich dann entscheiden, ob sie ein Buch von mir lesen wollten oder nicht.
Ja, auf Lesereisen wollte ich gehen. Aber wie? Ich konnte ja nicht ständig darauf hoffen, dass berühmte Kollegen krank werden.
Ich hatte vom Bödeckerkreis gehört. Für mich war das eine Art Geheimgesellschaft, in der sich große Schriftsteller versammelten, um ihre Lesereisen zu organisieren. Dort Mitglied zu werden oder gar in ihr Verzeichnis aufgenommen zu werden, schien aber fast unmöglich. Man hatte mir erzählt, ein Autor müsse mindestens drei Bücher in renommierten Verlagen veröffentlicht haben und außerdem gäbe es natürlich eine Qualitätskontrolle. Bödecker wolle ja nicht jeden schreibenden Deutschlehrer auf Lesereise schicken.
Nun, meine Verlage waren bestimmt nicht renommiert. Manchmal fragte ich mich sogar, ob es richtige Verleger waren.
In meinen Alpträumen versuchte ich, Mitglied im Bödeckerkreis zu werden. Ich betrat eine Halle, in der ein Dutzend von mir bewunderter Autoren saßen und mich mit strengen Gesichtern ansahen. Ich sollte ihnen etwas vorlesen. Schweißgebadet stammelte ich ein paar Sätze aus einem meiner Bücher herunter, und ich ahnte bereits ihr Urteil. In ihren Augen war ich eine Art Insekt. Auf keinen Fall aber mehr als ein lästiger Typ, der sie daran hinderte, endlich zu den wichtigen Dingen zu kommen, die sie zu besprechen hatten.
Ich schrieb einen Brief an einen gewissen Herrn Noack, der nicht nur Autor war, sondern wohl auch Verlagsleiter – und bei Bödeckers eine gewichtige Stimme hatte.. Ich traute mich aber nicht, den Brief abzuschicken.
Ich wollte dazugehören, wusste aber nicht, wie ich das anstellen sollte. Hätte man mich damals gefragt, was mir lieber wäre: ein Sitz in der Bundesregierung oder als Autor im Bödeckerkreis zu sein, ich hätte über die Antwort keine Sekunde nachgedacht. Nichts wäre mir wichtiger gewesen, als Autor im Bödeckerkreis zu sein.
Das Goethe-Institut, die Friedrich-Ebert-Stiftung – für mich kam zuerst dieser geheimnisumwobene Bödeckerkreis, dann ganz lange nichts. Dann vielleicht das Goethe-Institut und die Friedrich-Ebert-Stiftung.
Als ich abends zuhause saß und darüber nachdachte, wie ich dieses freie Leben noch länger durchhalten konnte, klingelte das Telefon. Ein Herr Bödecker meldete sich. Es wurde ein sehr langes Gespräch.
Offensichtlich wusste er mehr über meinen Beruf und die damit verbundenen spezifischen Probleme als ich selbst. Ruhig erklärte er mir Sachzusammenhänge, machte mir Mut und lud mich für eine Woche ein. Drei Veranstaltungen am Tag in Schulen sollte ich abhalten. Das Hotel wurde für mich bezahlt, die Fahrtkosten auch. Das Honorar, von dem er sprach, mag uns heute nicht üppig erscheinen. Für mich war es damals die Rettung. Das bedeutete, eine Lesewoche pro Monat und ich könnte den Rest des Monats ohne Sorgen schreiben.
Das Problem war nur, ich glaubte dem Mann am Telefon kein Wort. Ich dachte, dass mich jemand verarschen will. Denn der Mann dort behauptete, Herr Bödecker zu sein. Und das war für mich genauso absurd, als hätte mich Goethe vom Goethe-Institut oder Friedrich Ebert von der Friedrich-Ebert-Stiftung angerufen.
Ich beendete das Gespräch, nicht er. Ich sagte ihm, verarschen könne ich mich alleine und legte auf.
Wenige Tage später hatte ich für meine Tochter Milumil und eine Packung Pampers im Supermarkt geklaut, und wer weiß, wie sperrig diese Dinger sind, ahnt vielleicht, wie schwierig es ist, sie aus einem Supermarkt zu entwenden. Der Postbote kam. Ich ging gar nicht zur Tür. Das Öffnen der Post war zu der Zeit immer recht deprimierend. Zwischen Absagen von Zeitungen, Sendern und Verlagen fanden sich regelmäßig Mahnungen und unbezahlte Rechnungen.
Diesmal war noch etwas dabei: Eine Einladung nach Hannover. Eine Woche. Drei Lesungen am Tag. Genau wie der Typ am Telefon versprochen hatte. Dabei lag noch eine Einladung zum Tee. Das Ganze unterschrieben mit „Hans und Katja Bödecker“.
Nie wieder musste ich klauen gehen, um als Künstler zu überleben.
Das Ganze ist jetzt 25 Jahre her. Wenn man alles zusammenzählt, habe ich inzwischen mehr als 4000 Veranstaltungen gemacht, gut 2000 Nächte in Hotelzimmern geschlafen und habe mehr als fünf komplette Jahre meines Lebens, Sonn- und Feiertage eingerechnet, auf Lesereisen verbracht.
Das Treffen mit Hans Bödecker wurde zu einer lebensprägenden, ja lebensentscheidenden Begegnung für mich. Es machte aus einem vor sich hinstümpernden, erfolglosen Autor eine Art Handlungsreisenden in Sachen Literatur. Ich kann mir ein Leben ohne das gar nicht mehr vorstellen. Das Reisen und Vorlesen ist Teil meines Wesens geworden.
Oh ja, manchmal schimpfe und fluche ich. Dann sitze ich grippig und heiser in irgend einem Hotelzimmer, rufe Freunde an, die ich schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Dann kann ich klagen und jammern, weil ich Angst habe, dabei sozial zu entwurzeln – ja zu verwildern. Nicht alle Beziehungen halten so ein Nomadenleben aus. Dabei geht manche Freundschaft und auch so manche Ehe kaputt.
Meine Berufskollegen können ein Lied davon singen. Der Autor Jürgen Banscherus sagte einmal zu mir, bezeichnenderweise an einem Bahnsteig, unsere Züge fuhren in unterschiedliche Richtungen weiter: „Was tun wir eigentlich? Wieso fahren wir in Schulen und lesen Kindern Geschichten über Väter vor, die nie zuhause sind, während unsere eigenen Kinder zuhause auf uns warten?“
Ja, manchmal habe ich diese Art Leben gehasst. Wenn ich wieder mal einen eigenen Geburtstag allein auf Reisen in einem Hotelzimmer mit Blümchentapete feiern musste, oder wenn sich wieder ein Freund von mir verabschiedete, weil man Freundschaft eben auch leben können muss und das erfordert Anwesenheit.
Aber dann lernte ich mich besser kennen. Ich hatte eine schwere Herzoperation und wurde mitten im Herbst aus dem Lesegeschäft herausgerissen. Endlich war ich zuhause. Ruhig gestellt. Eine Weile genoss ich es sogar.
Kolleginnen schickten mir Briefe von den verschiedenen Jugendbuchwochen, für die ich eigentlich gebucht war und bei denen sie mich vermissten.
Endlich hatte ich Zeit, nahm an allen Feiern teil, traf Menschen meiner näheren Umgebung, die ich Jahre nicht gesehen hatte, war immer zuhause, wenn das Telefon klingelte. „Du bist dran? Ich dachte schon, es sei der Anrufbeantworter!“
Ich schrieb ein neues Buch und leierte ein Filmprojekt an. Aber dann spürte ich etwas, das zunehmend Besitz von mir ergriff: Eine Art Unruhe, gepaart mit Unzufriedenheit. Konnte es etwa sein, dass mir das alles fehlte? Der sumpfige Kaffee im Lehrerzimmer? Die Milch überm Verfallsdatum? Die Hotelzimmer an der Hauptverkehrsstraße? – Nein, das alles war es bestimmt nicht. Aber mir fehlte mein Publikum.
Ich spürte mich als Autor nicht mehr. Ich schrieb ein paar Szenen und fragte mich, ob sie gut waren. Noch vor wenigen Wochen hätte ich sie einfach ausprobiert. Das Lachen der Schüler hätte mich bestätigt, das Ausbleiben der gewünschten Schülerreaktion hätte mich dazu gebracht, alles zu streichen und noch mal neu zu formulieren.
Ich merkte, wie schnell aus mir ein quengeliger, spießiger, unausstehlicher Miesepeter werden konnte. Ich begann zu akzeptieren, dass ich das alles viel mehr brauchte, als ich es mir vorher eingestanden hatte.
Ich lehnte die Vorschläge der Ärzte, in eine Rehaklinik zu gehen, ab. Ich ging stattdessen auf eine Lesereise. Ich wollte mich wieder richtig spüren, mein Publikum sehen. Eben leben, wie es sich für eine Rampensau gehört.
Die Lichtgestalten und die Totalversager
Ja, es gibt sie wirklich – die Lichtgestalten der Leseförderung. Die stillen Helden der Kulturvermittlung. Sie machen aus jeder Lesewüste einen Geschichtengarten voller Phantasie. Ohne sie wäre der Kulturbetrieb in Deutschland etwa so dynamisch wie eine Bushaltestelle in der Lüneburger Heide.
Ich habe sie auf meinen endlosen Reisen kennen gelernt: die vielen kleinen Bödeckers. Die meisten sind Lehrer oder zumindest ehemalige Pädagogen. Wenn alles gut läuft, machen sie ihre Arbeit ehrenamtlich. Bei den meisten bin ich mir aber sicher, dass sie mehr Geld hineinstecken, als ihre Lebenspartner wissen. Ein Telefongespräch hier, ein Briefporto dort – so mancher Sparkassendirektor könnte Sponsor der Jugendbuchwoche werden, wenn man ihm vorher ein paar Bücher seiner Lieblingsautoren schickt, natürlich signiert, und eine Einladung zum Abendessen kann auch nicht schaden.
Und dann immer wieder Bücher. Natürlich Bücher. Man will doch wissen, wer was schreibt. Bevor sie einen Autor einladen, wollen sie sein Werk kennen lernen.
Und wenn die Autoren dann kommen, sind sie schließlich Gäste in der Stadt, jemand muss sie begrüßen, und gehört es sich nicht auch, einen Gast einzuladen, wenigstens auf ein paar Spaghetti und einen Rotwein beim Italiener? Wo soll der Etat für so etwas herkommen? Das zahlt mancher aus eigener Tasche, ist das Ganze doch mehr als eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Ein Hobby? Eine Leidenschaft? Vielleicht gar eine Sucht?
Während ich das schreibe, sehe ich sie vor mir: Konrad Pfannschmidt zum Beispiel, der seit inzwischen 22 Jahren in Hildesheim die Jugendbuchwoche organisiert. Jedes Jahr lädt er vier, fünf Autoren ein. 50, in guten Zeiten 70 Veranstaltungen. Jedes Jahr denkt er übers Aufhören nach und macht doch immer weiter. Sogar jetzt, obwohl er gar nicht mehr in Hildesheim wohnt.
Oder Rolf Stindl, der seit 1983 Lesereisen für Autoren nach Bremerhaven organisiert. Welcher Autor kennt ihn nicht? Gäbe es ohne ihn in Bremen und Bremerhaven überhaupt Begegnungen zwischen Schülern und Autoren?
Dann Frau Dr. Elke Haas aus Celle. Was sie als Kraftzentrum mit ein paar engagierten Lehrerinnen an ihrer Seite in dieser Kleinstadt auf die Beine stellt, sollte vorbildlich für sämtliche Städte in unserem Land sein. Dann sähe es anders aus, nicht nur bei PISA, sondern es wäre um die Literatur besser bestellt und um die Lesefreude. Wer das Leuchten in den Augen von Frau Dr. Haas sieht, wenn sie über ihre Sache spricht, ahnt, warum sie das alles tut: Sie liebt die Kinder, die Autoren und die Literatur.
Frau Dr. Haas schafft es, zunächst die Mittel aufzutreiben. Dass vieles in unserem Land nicht geht, weil kein Geld da ist, haben wir inzwischen alle gelernt. Wie man Menschen und Sponsoren begeistern kann, das kommt in der Lehrerfortbildung nicht vor.
Wenn ich in Celle bin, kriege ich eine Ahnung davon, wie viele hundert kleine Gespräche notwendig gewesen sein müssen. Selbst ein Schuhgeschäft macht mit und ein Kaffeeröster. Und sie alle sind einbezogen. Kinder- und Jugendliteratur spielt plötzlich in der Stadt eine Rolle. In fast jedem Schaufenster liegt ein Buch, meist ziemlich abgegriffen. Nie noch eingeschweißt. Daneben, auf einem schön gestalteten Papier, erzählt ein Kind, warum dies sein Lieblingsbuch ist. Manchmal sind auch Fotos von den Kindern oder den Autoren in den Schaufenstern ausgestellt.
Morgens werden zehn oder gar zwölf Autoren von Lehrern im Hotel abgeholt und in die einzelnen Schulen gebracht. Dort finden richtige Werkstattgespräche statt. Manchmal hat eine Klasse vorher einen Roman von mir gelesen und sich die Verfilmung angeschaut. Und dann reden wir miteinander.
Dies sind Glücksmomente des Deutschunterrichts. Noch heute schreiben mir Schüler, die so etwas vor 10 oder 15 Jahren erleben durften. Einige von ihnen sind inzwischen selbst Väter oder Lehrer geworden und aktiv dabei in der Leseförderung. Sie wurden damals angesteckt, mit einem Virus infiziert: Kunst und Phantasie sind hochgradig ansteckend und von Mensch zu Mensch übertragbar.
Vielleicht geht ja von Celle, Bremerhaven oder Hildesheim eine Initialzündung aus für den Rest der Republik. Natürlich gibt es auch anderswo solche Orte. Peine sag ich nur. Braunschweig. Oder auch Göttingen.
Das alles hat immer mit Einzelpersonen zu tun, die das literarische Leben um sich herum pulsieren lassen. Wo sie sind, da ist Literatur. Da findet Kunst statt.
Jetzt fällt mir auf, dass viele dieser Orte in Niedersachsen liegen. Vielleicht liegt es daran, dass dies das Bödecker-Stammland ist. Hier liegt das Epizentrum der Leseförderung.
Seit ich gemeinsam mit Bettina Göschl themengebundene CDs im JUMBO-Verlag herausbringe, haben die Lesungen eine neue Qualität erreicht. Zum Beispiel: Eine Grundschule lädt uns ein. Während Bettina in den ersten beiden Klassen ihre Lieder singt und sie mit den Kindern einstudiert, lese ich den Dritt- und Viertklässlern Geschichten vor von Rittern, Indianern und Gespenstern. So schaffen wir es oft, dass eine gesamte Grundschule an einem Tag „belesen und besungen“ wird.
Dann gibt es an der Schule einen Elternabend. Alle Eltern wurden hierzu schriftlich eingeladen. Mit ein bisschen Glück sind an der Schule genügend ausländische Kinder, deren Familien nutzen meist die Gelegenheit, um ein tolles Büffet aufzubauen. Eine Buchhandlung bietet auf einem Büchertisch die Bücher und CDs an, aus denen tagsüber vorgelesen wurde.
Jetzt kommen viele Eltern erstaunlicherweise nicht nur mit ihren Kindern, sondern sie werden geradezu von ihren Kindern mitgenommen. Denn die Kinder haben tagsüber in der Schule etwas Tolles erlebt und wollen das jetzt noch mal haben und mit Mama und Papa teilen.
So mancher Buchhändler sagte später, er hätte den größten Teil des Tages-Umsatzes seiner Geschichte gemacht. Oft bleibt bei solchen Veranstaltungen nicht mal mehr ein Schutzumschlag übrig, denn die Eltern decken sich ein für Weihnachtsgeschenke und Geburtstage und lassen sich natürlich Bücher und CDs signieren.
Viele Eltern kriegen wieder Lust, ihren Kindern etwas vorzulesen oder auch mit ihnen gemeinsam zu lesen und Lieder zu singen. In Köln sagte ein Schulleiter zu mir: „Glauben Sie, dass ich heute bei diesem Elternabend Eltern kennen gelernt habe, die ich noch nie im Leben gesehen habe? Die kommen nicht zu einem normalen Elternabend, bei dem der spannendste Punkt “Sonstiges„ heißt. Aber so was hier, das ist ja ein gesellschaftliches Ereignis.“
Solche Veranstaltungen, morgens an der Schule, abends der Elternabend, sind ein absoluter Glücksfall, denn hier ist alles miteinander verzahnt. Dies ist perfekt organisierte Leseförderung. Alle haben etwas davon. Die Schule, die Schüler, die Eltern, die Autoren und sogar der Buchhändler und die Verlage.
Es ist nicht immer und überall so gut verzahnt. Vielerorts gibt es wundervolle Lesungen mit engagierten Lehrern, aber wenn die Kinder danach mit der Autogrammkarte in die Buchhandlungen jubilieren, müssen sie feststellen, dass es die Bücher ihres Autoren dort gar nicht gibt.
Viele Kinder betreten in dem Moment zum ersten Mal im Leben eine Buchhandlung – und sie werden gleich frustriert. Der Buchhändler hatte keine Ahnung, dass der Autor in der Stadt ist.
Ich stelle meinen Verlagen Listen mit meinen Lesereisedaten zur Verfügung, damit der Vertrieb die Buchhandlungen vor Ort darüber informieren kann, wann ich wo bin, ja sogar, woraus ich vorlese. Hierbei kann ich eins ganz deutlich beobachten: Je kleiner der Verlag ist, umso wichtiger wird das genommen und umso sorgfältiger werden die Buchhandlungen betreut. Je größer der Verlag ist, umso mehr geht es der Vertriebsorganisation am Arsch vorbei. Da wird man höchstens hellhörig, wenn ein Autor etwas in einer Buchhandlung direkt macht.
In den einzelnen Orten gilt: je größer die Buchhandlung ist, umso schwieriger wird sie zu motivieren sein, ein Schaufenster zu machen oder sich auch nur ein paar Bücher des Autors auf Vorrat hinzulegen. Da hört man Sprüche wie: „Die 100 Euro mehr oder weniger an Umsatz machen den Kohl auch nicht fett.“
Die kleinen, engagierten Buchhandlungen dagegen, springen sehr gern auf den Leseförderungszug, wenn er nur mit Volldampf fährt. Dafür haben sie für einen Büchertisch abends in einer Schule aber oft nicht genug Personal. Wer schleppt dann die Buchkisten in die Schule und steht nachts hinterm Büchertisch? – Genau. Unsere stillen Helden der Leseförderung.
Sie tun das nicht wie Märtyrer, an denen immer die Scheißarbeit hängen bleibt. Im Gegenteil. Es macht Freude, ihr heimliches Grinsen zu sehen, wenn die Bücherstapel auf dem Tisch immer kleiner werden. Wenn sich zwei Jungs, die gestern noch Lesen „völlig langweilig und bescheuert“ fanden, um das letzte Piratenbuch zanken.
Ihr Plan geht auf. Es ist ihnen gelungen. Der Lesevirus breitet sich in ihrer Umgebung aus.
Aber wo so viel Licht ist, kommen natürlich auch die Schatten besonders gut zur Geltung. Es gibt nicht nur diese wundervollen Lehrer, die um sich herum die Verhältnisse zum Tanzen und die Schüler und Kollegen zum Lesen bringen. Dieser Bericht wäre verlogen, würde ich nicht auch von den anderen erzählen: den Totalversagern. Den Pennern, die mit ihrer Dummheit, Ignoranz und Faulheit alles, was leicht ist, schwer machen und alles was locker ist, verkrampft, und in ihrer Selbstbezogenheit nicht mal merken, welch große Chance sie gerade verspielen.
Sie schaffen es, 180 Kinder in eine Turnhalle zu pferchen. Natürlich gibt es keine Stühle für die Kinder, auf dem Boden sitzt es sich ja viel bequemer, und auf die sanfte Frage des Autors, ob er vielleicht ein Mikrophon haben könne, antwortet der erfahrene Pädagoge: „Wieso? Können sie das denn nicht ohne? Also, da müsste ich jetzt erst den Hausmeister suchen, aber ich weiß nicht, ob der…“
Sehr beliebt sind auch Eingangs- oder Durchgangshallen. Die Schüler dürfen dann auf den Treppen sitzen.
Ich fragte einen Lehrer, ob er denn in so einer Situation unterrichten würde. Er schüttelte den Kopf. „Nein, natürlich nicht. Ordnungsgemäßer Unterricht ist so nicht durchzuführen.“ Für eine Autorenlesung, so glaubte er, reiche es aber allemal.
Dass der Autor dabei noch viermal mehr Jugendliche vor sich sitzen hat als der Lehrer während des Unterrichts, ist für ihn eher unerheblich.
Autorenkollegen sind oft nette Menschen. Einfühlsam und verständnisvoll. Nicht alle haben das Durchsetzungsvermögen, in den wenigen Minuten vor Beginn der Veranstaltung für sich ein Setting zu organisieren, das eine erfolgreiche Lesung überhaupt erst möglich macht. Sprich, jeder Schüler hat einen eigenen Stuhl. Jeder Schüler sitzt so, dass er den Autor sehen kann. Die Schüler sind aus einer Altersstufe. Die akustischen Verhältnisse sind so, dass man den Autor, wenn er vorliest, hören kann. Er muss nicht schreien. Der Autor entscheidet, wann die Lesung beendet ist.
Das klingt jetzt alles sehr selbstverständlich. Ist es aber nicht. Ich erinnere mich an eine schöne Veranstaltung mit Drittklässlern. Drei dritte Klassen in einem Raum. Ich habe zwei Schulstunden zur Verfügung und einige mich mit den Schülern darauf, die Fünfminutenpause durchzumachen, damit die Lesung nicht unterbrochen wird.
Ich lese „Jens-Peter und der Unsichtbare.“ Die Lehrer amüsieren sich genauso gut wie die Schüler. Nach der ersten Kurzgeschichte beginnen die Schüler, Fragen zu stellen. Ich lese dann die zweite Geschichte vor, da geht plötzlich die Tür auf und ein Herr um die Fünfzig nickt mir freundlich zu.
Er hebt die Hand und sagt: „Lassen Sie sich nicht stören.“ Dann ruft er in den Raum: „Die 3 b jetzt bitte zu mir!“
Ich unterbreche natürlich die Lesung und frage ihn, ob das sein Ernst sei. Er sei gerade in eine Autorenlesung hineingeplatzt. Er könne sich gerne setzen und teilnehmen, aber die 3 b könne er jetzt natürlich nicht mitnehmen. Kein Künstler würde sich freuen, wenn man ihm das Publikum wegnimmt.
Er lachte, das mache doch alles gar nichts, dafür käme ja schließlich jetzt die 3 d zu mir.
Ich will das nicht und wehre mich. Er ist uneinsichtig und klagt mich sogar an, das sei ja wohl ungerecht, dann käme die 3 d ja nicht in den Genuss, der Raum sei schließlich zu klein für alle vier Klassen.
Drei Grundschullehrer sitzen hinten und erleben alles mit. Ich kann es ihnen ansehen: es ist ihnen peinlich. Sie kennen den Kollegen. Er ist der berühmte Elefant im Porzellanladen. So eine Sprechblasenfigur, über die man im Comic gut lachen kann.
Tilman Röhrig setzt bei seinen Lesungen gern die Lehrer auseinander, „weil die sonst so viel schwätzen“. Besonders beliebt bei Autoren sind auch Lehrer, die hinten sitzen und während der Lesung Hefte korrigieren. Ich spreche sie gern nach den Lesungen an und frage sie, ob sie wissen, was sie getan haben.
„Na klar“, sagen sie. „Hefte korrigiert.“
Aber das stimmt leider nicht. In der Tiefe haben sie den Schülern demonstriert, wie wertlos das ist, was da vorne passiert. Sie haben offenes Desinteresse an den Tag gelegt.
Manch Lehrerverhalten grenzt an Sabotage.
Wie kommt das? Sind sie dumm? Schlecht ausgebildet? Oder schlägt bei manchem eine Art pädagogische Eifersucht durch, wenn er sieht, dass seine Schüler einem anderen an den Lippen hängen und selbst die, die sonst immer so unruhig sind, plötzlich brave, aufmerksame Schüler werden?
Ich glaube, ihr Verhalten zeigt uns einfach nur, welche Bedeutung Literatur und Kunst sonst im Leben für sie haben. Nämlich überhaupt keine.
Ich wette, dass keiner dieser beispielhaft negativen Lehrer auch nur einen Satz von dem Autor gelesen hat, der in seiner Klasse zu Gast ist. Natürlich werden sie nie gegen Leseförderung auftreten. Sie glauben, dass es politisch korrekt sei, für Bücher und gegen Filme zu sein. Ihr letztes Buch haben sie während des Studiums gelesen und auch das nur, weil sie eine Facharbeit darüber schreiben mussten.
Solche Lehrer sind oft bei den Lesungen völlig erstaunt, denn wenn die Schüler Fragen stellen, erfahren sie auch einiges über den Autor – sofern sie nicht hinten Hefte korrigieren. Ich habe regelmäßig dann ihre volle Aufmerksamkeit, wenn sie hören, dass ich nicht „nur“ Kinderbücher geschrieben habe, sondern auch viele „Tatorte“, denn „Tatort“ gucken sie auch – sonntagabends, zusammen mit ihrem Lebenspartner, und dabei ein Gläschen Rotwein. Oft höre ich dann Sätze wie: „Ja, wenn ich vorher gewusst hätte, welch ein berühmter Mann an unsere Schule kommt, dann hätte ich natürlich…“
Lehrer, die sich lauthals beim Autor darüber beschweren, dass ihre Schüler eigentlich nicht mehr lesen, haben oft selbst ein sehr gebrochenes Verhältnis zum Buch. Was in solchen Fragen gipfelt, wie: „Ich hätte ja gerne meinen Schülern vorher ein Buch von Ihnen gezeigt. Aber wie soll ich denn da drankommen?“
Ich antworte dann gerne: „Bücher kauft man in der Metzgerei. Das weiß doch jeder. Da müssen Sie nur einen Ihrer Kollegen fragen.“
Neulich wendete sich ein Schüler verständnislos an seinen Deutschlehrer und fragte: „Warum haben Sie uns denn nicht gesagt, dass der Herr Wolf kommt? Ich hätte dann meine Bücher zum Signieren mitgebracht. Ich habe so einen Stapel von ihm.“
Peinliche Situation. Ja, warum hat der Lehrer den Schülern nicht gesagt, wie der Autor heißt, der sie besuchen kommt?
Nun, er ist einfach nicht darauf gekommen. Er war überlastet. Überhaupt sagen ihm die Namen der neuen Autoren wenig. Cornelia Funke hat er noch nichts gehört. Seine Kenntnis von Literatur endet bei dem jungen Martin Walser. Von dem hat er auch nichts gelesen, aber da hat es neulich mal einen Skandal gegeben. Hat der nicht auf einen Kritiker geschossen?
Schon sehr früh bekam ich als junger Autor von einem erfahrenen Kollegen den Rat: „Wenn du zu einer Schule musst, verlass dich nie auf die Anreisebeschreibung.“
Da ist etwas dran. Nur die wenigsten Lehrer wissen, mit welchen öffentlichen Verkehrsmitteln man ihre Schule erreichen kann. Ab Oberstudienrat spätestens ist so etwas vorbei. Dann muss man schon froh sein, wenn sie die Straße kennen, an der ihre Schule liegt.
Manchmal, wenn man vergessen hatte, mich abzuholen, stand ich in irgendwelchen verregneten Städten herum und wusste: Die Zeit läuft. Gleich fängt die Schule an. Du solltest längst da sein. Ach, was habe ich da schon Lehrer am Telefon stammeln hören, wenn sie mir den Weg erklären sollten.
Eins habe ich gelernt: Frag nie einen Erdkundelehrer. Dann muss ein Autor nämlich Gesteinsproben nehmen, um den Weg zu finden. Erdkundelehrer kennen sich überall aus, bloß nicht in der Stadt, in der sie leben.
Zum Abschluss möchte ich eine persönliche Geschichte erzählen. Sie ist gerade erst passiert. In Rheinland-Pfalz.
Ich war in einer Hauptschule. Nein, nicht in der Eingangshalle. Man gab mir den Musikraum. Alles lief klasse. Nach der ersten Lesung sagte mir die Direktorin: „Lassen Sie Ihre Sachen ruhig hier im Raum, ich schließe ab. Die nächste Lesung ist dann wieder hier.“
Ich weiß. Es war blöd von mir. Ich hätte alles mitnehmen müssen. Man darf sich auf so etwas nicht verlassen. Aber ich war gut gelaunt, die Sonne schien und ich hatte das Gefühl, es könnte ein Glückstag für mich werden.
Ich ließ meine Tasche mit Büchern und Autogrammkarten im Raum, ebenso eine Flasche Mineralwasser, ein Glas, eine Tüte Hustenbonbons und meine Uhr. Ich lege meine Uhr immer auf den Tisch, um mit einem kurzen Blick die Zeit kontrollieren zu können.
Vor der zweiten Lesung trank ich mit den Lehrern eine Tasse Kaffee. Nicht sumpfig, keine Milch überm Verfallsdatum – welch ein Tag!
Aber dann war ich plötzlich ganz allein im Lehrerzimmer. Wie ein Bienenschwarm huschten sie auseinander.
Als ich den Musiksaal wieder gefunden hatte, herrschte dort schon gute Stimmung. Ungefähr 80 Acht- und Neuntklässler versuchten, sich gegenseitig niederzubrüllen. Ein Mädchen hatte Nasenbluten und ein Aussiedlerjunge fragte, ob er an der Veranstaltung teilnehmen müsse, denn ich hätte ja auch Bücher über Schwarze Magie geschrieben. Er meinte die Fantasyreihe „Das magische Abenteuer“ im Franz-Schneider-Verlag.
Ich sah sofort, dass meine Uhr weg war. Außerdem fehlten ein paar Hustenbonbons. Jemand hatte mir ins Wasserglas gespuckt, aber sonst war alles in Ordnung.
Nach einigen Minuten hatte ich es geschafft. Die Schüler saßen, die Lehrerinnen beruhigten sich. Das Nasenbluten kam zum Stillstand. Der Aussiedlerjunge blieb, setzte sich aber mit seinen Freunden in die letzte Reihe und wollte „auf keinen Fall bezahlen“.
Vor mir flegelten sich achtzig Jugendliche, die keine Lust hatten. Sie fanden Schule doof und wer da auftrat, musste auch doof sein.
Ich erzählte ihnen nicht von meinen Siegen, sondern von meinen Niederlagen. Von Romanen, die keiner drucken wollte, von Verfilmungen, die schief gingen, und etwas davon erreichte sie. Die ersten setzten sich anders hin. Die Gesichter entspannten sich. Ein angeblich hyperaktiver Junge in der ersten Reihe war besonders aufmerksam.
Schließlich kam es zu einem der großen Momente, wenn Künstler und Publikum sich begegnen: etwas, das immer wieder geschieht und vielleicht die eigentliche Triebfeder, warum Menschen wie ich so etwas tun. Plötzlich versteht man sich, entdeckt Gemeinsamkeiten, hat sich etwas zu sagen, lacht über die gleichen Dinge, hört sich gegenseitig zu. Es entsteht fast so etwas wie Komplizenschaft zwischen Publikum und Autor.
Ich sah in die Gesichter und dachte bei mir: Wer von ihnen mag deine Uhr geklaut haben, Klaus-Peter? Es tut ihm jetzt bestimmt leid. Jetzt, da du nicht mehr „irgend so´n Typ bist, der kommt, um uns was vorzulesen“, sondern ein Künstler, den man mag, ja mit dem man sich vielleicht sogar identifiziert.
Komischerweise ging ich davon aus, dass ein Junge die Uhr geklaut hatte. Keine Ahnung, warum.
Am Ende holten sie sich noch Autogramme, wollten meine Adresse wissen, um mir zu schreiben und irgendwie war alles gut – bis auf die Uhr. Ein Erbstück meines Vaters, die ich doch so gern wieder gehabt hätte.
Ich versuchte, den Schülern eine goldene Brücke zu bauen. Sagte, dass die Uhr mir sehr wertvoll ist, ich hätte die wahrscheinlich an der Schule verloren und wer sie findet, solle sie doch der Lehrerin geben.
Die Lehrerin zerstörte diese Brücke gleich auf pädagogisch sehr wertvolle Weise, indem sie rief: „Was? Hat einer Ihre Uhr geklaut?“
Ich gab meine Uhr schon verloren, denn wer jetzt mit der Uhr zu ihr kam, galt als Dieb.
Im Lehrerzimmer diskutierten wir noch eine Weile, warum die Schüler erst so abweisend waren und mir später so zugetan. Ich deutete an, das könne auch etwas mit der Vorbereitung zu tun haben.
Dann ging ich zu meinem Auto. Am Scheibenwischer baumelte die Uhr.
Irgendwie verbuchte ich das innerlich als Sieg. Als Zeichen, dass eine Autorenbegegnung – wie Hans Bödecker es immer so schön nannte – etwas bewegen und verändern kann.
Was du tust, macht einen Sinn, dachte ich und fuhr weiter in die nächste Stadt.